Ein Beitrag von
Brian Gibson
Technische Universität Berlin
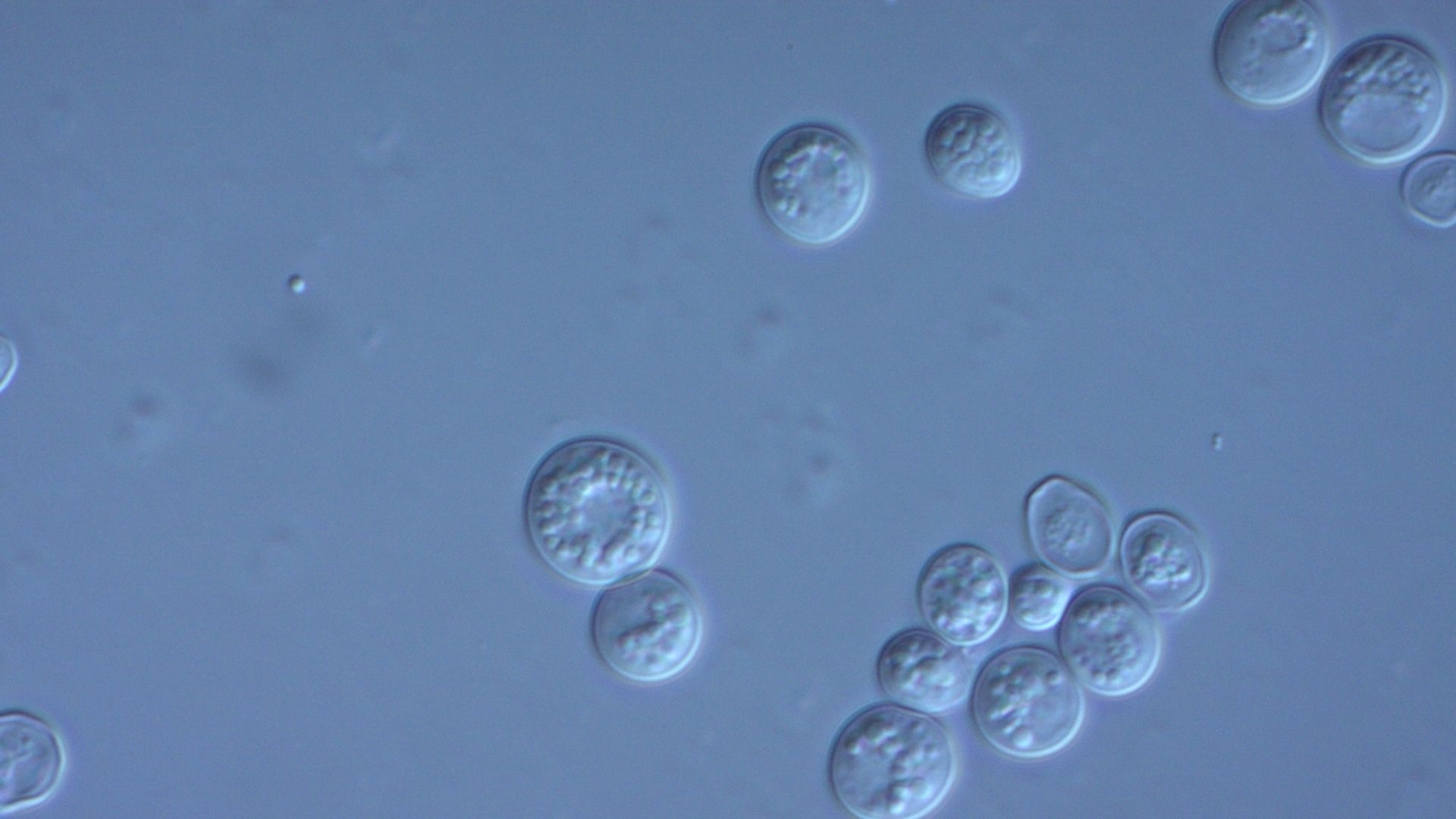
Kontaminationen mit diastatisch aktiven Hefen sind in den letzten Jahren angestiegen, Hand in Hand mit der wachsenden Beliebtheit von Bieren wie Pale Ales und IPAs. Eine Nachgärung im Gebinde führt oft "nur" zu höherem Alkoholgehalt, Fehlaromen oder Gushing, im Extremfall aber zu Bombagen von Behältern aufgrund von CO2-Bildung. Dr. Nerve Zhou von der Botswana International University of Science and Technology und Prof. Brian Gibson von der Technischen Universität Berlin sind zusammen mit anderen Forschern der globalen Population diastatisch aktiver Hefen auf der Spur.
Veröffentlicht am 06/02/2025
Ein Beitrag von
Brian Gibson
Technische Universität Berlin

Malzersatzstoff
Ein Beitrag von Christian Schubert
Mehr erfahren

KI und Hopfentrocknung
Ein Beitrag von Mariana Barreto Carvalhal Pinto
Mehr erfahren

Nachhaltigkeit
Ein Beitrag von Christof Ermert
Mehr erfahren

Purification
Ein Beitrag von Dr. Jürgen Hofmann
Mehr erfahren